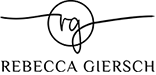Zu Beginn der letzten Sommerferien, an die sich eigentlich eine Elternzeit anschließen sollte, werde ich auf eine Ausschreibung aufmerksam: Programmmitarbeit für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung im Projekt „Erfolg macht Schule“, in dem Einzelschulen in vielfältiger Form in ihrem Schulentwicklungsprozess begleitet werden. Meine Vision, in einer Organisation mit Schulbezug tätig zu sein und gleichzeitig selbstständig Workshops und Coaching anzubieten, wird auf einmal ganz konkret. Ich bewerbe mich. Es ist die erste Bewerbung seit Jahren und ich lese erstmal nach, wie mittlerweile Lebensläufe und Anschreiben verfasst werden. Zu den letzten 9 Jahren kann ich kein Arbeitszeugnis vorlegen, höchstens den Beurteilungsbogen aus meiner letzten Beurteilungsrunde 2014, in dem die Kreuze, zumindest in Thüringen, mehr oder weniger so gesetzt werden, wie sie den Schulleiter*innen durch die Administration prozentual vorgegeben werden, aber das ist ein anderes Thema.
Für Sie immer noch Du!
Voller Vorfreude bereite ich mich auf das Gespräch vor, zu dem ich eingeladen werde. Welche Fragen könnten kommen? Welche Fragen habe ich? Zu Beginn wird schnell geklärt, dass das Du etabliert ist. Einfach so. Ohne Warten, dass der Ältere das Du anbietet. Total verrückt! Offen, neugierig und respektvoll lernen wir uns gegenseitig kennen.
Eine Woche nach meinem Bewerbungsgespräch kommt ein Anruf meines potenziellen Teamleiters. Etwas aufgeregt, in Erwartung einer Zu- bzw. Absage, gehe ich ran. Es folgt ein Gespräch, mit dem ich nie gerechnet hätte. „Ich wollte mal hören, wie es dir nach dem Gespräch ging, ob du noch Fragen hast und dich über den Stand des Bewerbungsverfahrens informieren, das sich etwas hinauszögert.“ Am Ende dieses wertschätzenden, offenen und freundlichen Gesprächs mache ich noch einen kleinen Scherz. „Falls ich in euer Team komme, dann werde ich bei der Frage ‚Wie geht’s?‘ wahrscheinlich zurückfragen, was ich falsch gemacht habe. Eine absichtsloses Fragen nach dem Befinden kenn ich nicht!“ Gelächter auf beiden Seiten. Unter uns: Es lässt meinerseits auch tief blicken.
Deci und Ryan wären begeistert
Die Zusage löst ein innerliches Glücksfeuerwerk aus. Ich verabschiede mich zwar erstmal von der geplanten Elternzeit, doch eröffnet sich gleichzeitig ein Tor zu Autonomie, Selbstwirksamkeit und Integrität (nein, ich übertreibe nicht, nicht mal geringfügig!). Nun gilt es ‚nur‘ noch zu kündigen, über diesen „Elsamoment“ habe ich hier bereits erzählt.
Bis zu meinem Einstieg in die Stiftung verbringe ich den Tag mit der so genannten Kaltakquise. Ich rufe bei Beratungsstellen, Organisationen, Vereinen und Schulträgern an und stelle mich und mein Angebot vor. Ich rechne anfangs damit, abgewimmelt zu werden, sehe knallharte Sekretär*innen vor mir, die ihre Leitungen vor lästigen Werbeanrufen schützen wollen oder Mails, die unbeantwortet bleiben und im weiten Äther ziellos verschwinden. Doch weit gefehlt! Ich treffe auf neugierige, freundliche und offene Menschen, wir vereinbaren Kennenlerntermine, ich schicke mein Angebot per Mail und verweise auf konkrete Angebote. Selbst diejenigen, für die mein Angebot aus strukturellen Gründen nicht in Frage kommt, nennen mir andere Träger, die potentiell Interesse haben. Ich erfahre Dank für das Gespräch, Zuspruch, Empathie und Wertschätzung. Es entstehen Veranstaltungsreihen, Workshopideen und Inhouseanfragen. Innerhalb von kurzer Zeit führe ich eine lange Liste mit interessierten Organisationen. Selbst nach täglich 3 Stunden Telefonieren berichte ich meinem Lieblingsmenschen begeistert von meinen Begegnungen. Dass ich selbst entscheide, wen ich kontaktiere und was ich anbieten möchte, löst in mir einen Selbstwirksamkeitsüberschuss aus, den ich so nicht kenne. Nach einigen Wochen wird am Mittagstisch ein Satz geäußert, der immer noch in mir nachhallt: „Wenn ich sehe, wie du dich über (für mich) völlig normale Dinge freust, wird mir nochmal klarer, wie du vorher gearbeitet haben musst.“
Mit einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen
Mittlerweile habe ich in der Stiftung angefangen und entdecke mit meiner ehemaligen Lehrerbrille, „Ungeheuerlichkeiten“. Da gehört das Du zur Organisationskultur. Mir klingen noch Lehrer*innen im Ohr, die ich bis heute sieze, weil ein Du potenziell eine ungewünschte Nähe und möglicherweise einen Autoritätsverlust nach sich zieht. Die Hierarchisierung in Schule ist auch wieder ein anderes Thema.
Ich kann meine Ideen einbringen, eigene Workshops anbieten, selbstständig recherchieren und werde strukturiert in einem Onboardingprozess eingearbeitet, zentrale Fortbildungen und regelmäßige Gespräche inklusive. Ich spule kurz im Kopf zurück zu meinen Einstiegstagen in Schulen. Es gab eine Begrüßungsmappe, den Universalschlüssel und ab dann glich es teilweise einem Osterspaziergang auf der Suche nach relevanten Informationen. Schließlich habe ich Lehramt studiert und das 2. Staatsexamen, das wird ja wohl reichen. Ohne die Unterstützung von Kolleg*innen wäre ich mitunter aufgeschmissen gewesen.
Es folgt der nächste Hammer. Alle Aufgaben werden im Team bearbeitet, niemals allein. Auch das gehört zur Organisationskultur. Ich kann jederzeit rückfragen, Aufgaben aufteilen, gemeinsam Ideen entwickeln, Prozesse gemeinsam auswerten und für Herausforderungen gemeinsam nach konstruktiven Lösungen suchen. Hatte ich schon das Wort „gemeinsam“ erwähnt?
Mein Arbeiten 4.0
Das Ganze gipfelt in einem SharePoint, auf den alle Mitarbeitenden Zugriff haben. Jeder entwickelte Workshop oder Flyer steht allen zur Verfügung. Ich kann es nicht glauben. Ohne Leistungsvorschuss wird mir ein Netzwerk an Wissen zur Verfügung gestellt und geteilt? Ich stelle mir kurz vor, wie das in der Schule hätte sein können, wenn alle ihre Vorbereitungen digital teilten. Ich gebe ein Suchwort ein und erhalte einen Stundeverlauf mit notwendigen Materialien als Grundlage, die ich dann für die Lerngruppe aufgreifen kann. Im Gegenzug teile ich natürlich meine Vorbereitungen. Ich höre Kolleg*innen, die dann berichten, wie sie mal etwas teilten und sich dann ausgenutzt fühlten, weil nichts zurückkam oder Materialanfragen kategorisch verneint wurden. Also werden Schätze gehütet, in die viel Zeit investiert wurde und die teilweise nur einmal Anwendung finden. Nicht dass jemand anderes ohne Leidensdruck vom eigenen Wissen profitiert oder das geteilte Wissen als sein eigenes verkauft.
Lehrer*innen sind aus unterschiedlichsten (strukturellen) Gründen mehrheitlich Einzelkämpfer*innen. Unseren Lernenden versuchen wir jedoch zu vermitteln, dass Teilen zu guter Erziehung gehört und proben in kooperativen Lernformen den Mehrwert vom gemeinsamen Aufgabenlösen. Was wäre, wenn wir Schulkulturen entwickelten, in denen auch Pädagog*innen natürlicherweise zusammenarbeiteten und Wissen teilten? Es verändert nämlich das Arbeitserleben substantiell. Es bereitet mir Freude, mein Wissen zu teilen und den Zugewinn von Kooperation tatsächlich zu erleben. Geben und sich zu verbinden ist eines der wichtigsten Bedürfnisse. Ich erfahre Wertschätzung, Unterstützung, Erleichterung, Sicherheit und trotzdem Selbstwirksamkeit und Autonomie.
Das soll weder eine Hymne auf meine Selbstständigkeit bzw. die Stiftung sein (ok, eine kleine) noch ein pauschales Nachtreten in Richtung Schule. Mir eröffnen sich gerade neue Welten, meine persönliche Arbeitswelt 4.0 und ich bin dankbar und glücklich. Ich frage mich, wie Schule ein Arbeitsort werden kann, an dem Kooperation, Wertschätzung und Autonomie als Organisationswerte umgesetzt werden. Es gibt sie schon in zahlreicher Form, diese Schulen, und Pädagog*innen, die diese Werte leben, jedoch brauchen Pädagog*innen strukturell noch mehr Unterstützung und Tools im Schulalltag. Eine Möglichkeit ist die Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg. Wie das genau auf die pädagogische Praxis übertragen werden kann, erfährst zu zum Beispiel hier:
- Am 10.11.2020 von 13:00-14:30 Uhr in meinem kostenlosen Workshop im Rahmen der Woche der pädagogischen Beziehungen der Helga-Breuninger-Stiftung
- In meiner Onlinereihe zum wertschätzenden Miteinander im Schulalltag „Was soll denn das!“
- In dem Einführungsseminar Gewaltfreie Kommunikation im Schulalltag „Das will ich aber überhört haben!“