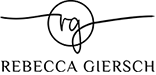Kinder ähneln ihren Eltern, ist das nicht verrückt? „Ich hatte gestern Elterngespräch mit den Eltern von Hannah. Nach 2 Minuten mit der Mutter war mir alles klar. Da brauchst du dich nicht wundern, warum Hannah sich so verhält!“ Nicht selten habe ich rückblickend nach Elterngesprächen ähnlich gedacht und es häufig von Kolleg:innen gehört. Im Subtext schwingt dabei einerseits Erleichterung mit, die (vermeintliche) Verhaltensursache erkannt zu haben, dass das Verhalten damit erklärbar scheint und ich als Pädagog:in nichts dafür kann. Gleichzeitig schwingt eine mitunter wenig wertschätzende Haltung gegenüber den merkwürdigen, eigentlich abzugewöhnenden Eigenheiten eines Kindes vice versa der Eltern mit.
Dass Kinder ihren Eltern ähneln, liegt jedoch in mehrfacher Hinsicht in der Natur der Sache, nicht nur biologisch gesehen. Sorgeberechtigte und Kinder verbringen den Alltag miteinander, leben zusammen, wenn auch manchmal nur wochenweise. Gemäß traditioneller Lerntheorien lernen Kinder u.a. am Modell, also vor allem von den Menschen, mit denen sie zusammenleben und denen sie sehr nahestehen. Darüber hinaus spielen Gene auch eine nicht zu vernachlässigende Rolle in Bezug auf Charaktereigenschaften und die Art und Weise, der Welt zu begegnen. Zu guter Letzt sind Kinder Teil des Familiensystems und verhalten sich, systemisch betrachtet, im jeweiligen Kontext absolut funktional.
„Bei den Eltern…!“
Ich möchte das Eingangszitat einmal übertragen. Man stelle sich vor, Schüler:innen würden die Eltern der Lehrpersonen kennenlernen. Wäre es da nicht auch oft naheliegend, dass sie sagen: „ Ah, jetzt verstehe ich, warum Frau Müller da manchmal so komisch ist. Bei den Eltern!“? In der Auseinandersetzung mit meiner Ursprungsfamilie wird mir selbst auch einiges klar und dieses Erkennen hilft mir, mich selbst zu verstehen, es anzunehmen und wertzuschätzen oder es gehen zu lassen. Sollte es überhaupt mein Anspruch sein, mich aus meiner Ursprungsfamilie mehr als einen Schritt zu lösen und ist das überhaupt möglich? Was erwarten wir Pädagog:innen folglich unbewusst von den Schüler:innen? Dass sie ihre Ursprungsfamilie verneinen und damit auch sich selbst? Stattdessen könnte ein erster Schritt sein, sich als Pädagog:in bewusst zu werden, dass ich das Verhalten der jungen Menschen nicht kontrollieren kann, sondern lediglich mein eigenes. Das Verhalten der Lernenden kann ich erstmal als solches annehmen. Um nicht missverstanden zu werden: Es geht mir nicht darum, jegliche Verhaltensweisen zu befürworten und zu billigen. Die Grenzen mögen hier manchmal fließend sein. Einer Person bedingungslos auf Augenhöhe zu begegnen, schließt für mich ein, Person und Verhalten zu trennen. Gerade im pädagogischen Kontext kann ich das auch transparent machen: “Du bist mir wichtig und ich möchte, dass du weiter auf der Schule deinen Weg gehen kannst. Dass du andere trittst und beleidigst, kann ich nicht hinnehmen.“
Darüber hinaus spielt in der Situation, die ich eingangs schilderte, auch eine gewisse Art der selbsterfüllenden Prophezeiung eine Rolle. Wenn ich bei jungen Menschen herausforderndes Verhalten erlebe, dann gehe ich auch mit entsprechenden Erwartungen in das Gespräch mit den Eltern. Mein Fokus richtet sich nicht nur bei dem Kind auf das herausfordernde Verhalten, sondern auch unbewusst bei den Eltern. Es ist dann so, als würde meine Wahrnehmung nur darauf lauern, dass das Verhalten kommt.
„Da werden deine Eltern aber enttäuscht sein!“
Sorgeberechtigte werden auch gern bei Unterrichtsstörungen oder Konflikten als Drohung bzw. Strafe eingesetzt, wie ich bereits in meinem letzten Beitrag schilderte. Dabei scheint es mitunter eine Strafe für alle Seiten zu sein. Während es Eltern aus der Kindertagespflege und der Kindergartenzeit gewöhnt sind, oft täglich etwas über die Entwicklung ihrer Kinder zu erfahren, heißt der Anruf aus der Schule meist nichts Gutes. Sorgeberechtigten fehlt der Einblick in den Schulalltag und sie werden häufig nur bei Problemen hinzugezogen. Vor allem dann, wenn sich Pädagog:innen als hilflos erleben und hoffen, dass die Eltern Konsequenzen durchführen bzw. durch ihre Autorität auch in den Schulalltag hineinwirken. Was erwarten Pädagog:innen eigentlich genau von den Eltern? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein wütender Anruf aus der Schule den ein oder anderen Elternteil an die eigene Schulzeit erinnert oder sogar soweit antriggert, dass die erwachsene Person in die Schülerrolle rutscht. Darüber hinaus können bei den Eltern statt der Sorge der Lehrpersonen auch Vorwürfe ankommen. Dann wiederum gehen sie eher in die Verteidigungsrolle, zum Gegenangriff über oder verfallen in eine abweisende Starre. Ein konstruktiver und wertschätzender Austausch ist dabei kaum möglich und es verhärten sich ggf. die Fronten.
Mehr als eine Sichtweise
Gleichzeitig haben die Lernenden Angst und sind unsicher, weil sie nicht immer wissen, ob der Anruf unangenehme Folgen hat. Dazu kommt, dass das Gespräch meist einseitig erfolgt, weil die Lehrperson mit den Eltern in Abwesenheit des Kindes spricht. Die Wahrnehmung des Kindes wird per se als übereinstimmend mit der Sicht des Erwachsenen angenommen. Aber gibt es nicht immer mindestens zwei Perspektiven? Werde ich als betroffener junger Mensch auch die Gelegenheit bekommen, meine Sicht zu schildern? Wie wäre es, wenn ich im Sinne der Transparenz und des Respekts gemeinsam mit den Lernenden die Eltern anrufe? Wie wäre es, wenn der Elternanruf oder die Elterninformation in der Form ritualisiert wird, dass auch bei angemessenem Verhalten oder bestimmten Entwicklungsschritten Kontakt zu den Eltern erfolgt? Das ist im Schulalltag natürlich nicht bei allen Lernenden möglich, aber zumindest im Wechsel und zumindest bei denen, deren Verhalten einer wachsamen Sorge bedarf.
Zu guter Letzt sind die Anrufe bei Eltern nach Konflikten natürlich auch für die Pädagog:innen Herausforderungen. Wie kann ich wertschätzend bleiben, wenn sich mein Gegenüber in Vorwürfen verliert? Erreiche ich überhaupt jemanden und werde ich von den Eltern verstanden und unterstützt? Wie kann ich ein Gespräch höflich und klar strukturieren und ggf. beenden?
Expert:innen zusammenbringen
Felix Winter weist darauf hin, dass „der familiäre Hintergrund in den Industrieländern einen etwa doppelt so großen Einfluss auf den schulischen Erfolg hat als die Schule selbst.“ [1] Auch wenn diese Erkenntnis wissenschaftlich bereits ein alter Hut zu sein scheint, so ist die Kooperation zwischen Sorgeberechtigten und Schule noch lange nicht im Schulalltag etabliert. Das zeigt sich nicht nur bei Verhaltensauffälligkeiten, sondern bereits zu Beginn der Schulzeit. Je nach Landesrecht haben Eltern mitunter keinerlei Mitspracherecht, in welche Schule ihr Kind eingeschult und ob es besser zurückgestellt werden sollte. Das entscheidet dann wie hier in Thüringen ein Amtsarzt nach 30minütiger Untersuchung und der Schulleitende der zukünftigen Grundschule, der das Kind in der Regel noch nie gesehen hat. Dabei habe ich manchmal den Eindruck, dass Eltern vorgeworfen wird, dass sie unsachlich seien, ihre Kinder nur schützen wollen (ist das schlimm?) und vor lauter bedingungsloser Liebe keinen realistischen Blick mehr haben. Warum fangen wir nicht an, Eltern ebenfalls als die Expert:innen zu sehen, die sie sind, nämlich die ihrer Kinder?
Kooperation von Anfang an
Wenn ich an anstrengende Elterngespräche zurückdenke, in denen Eltern mir erklären wollten, was ich methodisch und didaktisch anders machen soll, damit der Unterricht besser funktioniert, glaubte ich meine pädagogische Kompetenz angezweifelt und wurde wütend und frustriert. „So eine Unverschämtheit! Ich gehe ja auch nicht auf deren Arbeit und erzähle ihnen, wie sie es besser machen können!“ Mittlerweile bin ich aber davon überzeugt, dass ich diesen Eltern weder ausreichend empathisch auf Augenhöhe begegnet bin, noch sie mit ihrem Wissen über ihr Kind und mit ihrem Hintergrund wirklich ernst genommen habe. Ich habe mich innerlich als Pädagogin abgegrenzt und mein Revier markiert. Allerdings leben auf diesem Revier die Kinder dieser Eltern und was uns Erwachsene eint, ist, dass wir den Kindern die beste Entwicklung ermöglichen wollen. Wann setzen wir uns also endlich gemeinsam an einen Tisch und kooperieren als Expert:innen?
Wenn wir dann für alle Beteiligten öffentlich zeigen, dass wir das gleiche Ziel verfolgen, uns gemeinsam austauschen und unterstützen, dann wirkt sich dies auch nachhaltig bei herausforderndem Verhalten aus. Die Erwachsenen werden in ihrer Führungsrolle gestärkt und erleben gleichzeitig Wertschätzung, Empathie und Respekt. Gerade diese 3 Bedürfnisse sind im Kontext Schule zu wenig erfüllt.
Ein möglicher Ansatz dafür ist die Neue Autorität, die du am 27.5. kennenlernen kannst. Die Gewaltfreie Kommunikation kann dabei Sprach- und Orientierungshilfe sein. In meinem Einführungsworkshop am 26.5. stelle ich dir das Modell und die 4 Schritte vor.
[1] Winter, Felix (2015): Lerndialog statt Noten. Weinheim. S. 225.